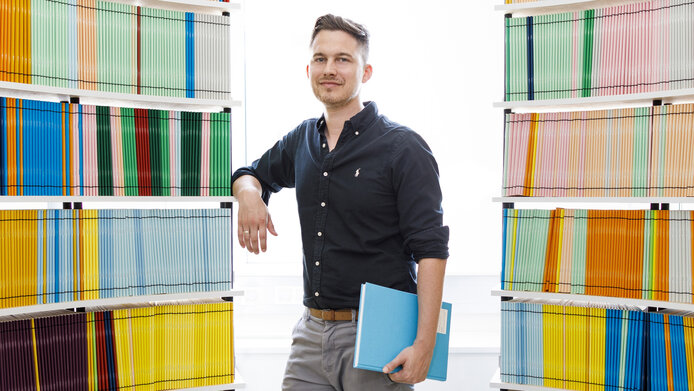Im Lauf des Lebens sammeln sich viele genetische Mutationen in den Zellen des Körpers an – Veränderungen, die fatale Folgen haben können. Die mutierten Gene können dafür sorgen, dass neue Proteine entstehen, die das empfindliche Gleichgewicht der Zelle stören: Sie aktivieren fälschlicherweise Signale oder unterbinden sie. Sie fördern die Zellteilung oder verhindern, dass Zellen absterben. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Krebserkrankung.
Es bestehen zwar zelluläre Systeme, um fehlerhafte Proteine zu eliminieren. Sogenannte E3-Ubiquitin-Ligasen sind Teil eines zellulären Recyclingsystems. Sie erkennen Proteine mit „Baumängeln“ und markieren sie für eine gezielte Zerstörung. Doch die krebserregenden Proteine, die auf mutierten Genen beruhen, werden meist nicht erkannt. Ein vielversprechender Ansatz in der Medizinforschung setzt genau hier an. Er versucht bei der Markierungsarbeit nachzuhelfen, damit die außer Kontrolle geratenen Proteine dennoch als fehlerhaft erkannt und abgebaut werden.
Ein Wissenschaftler, der seit Jahren die Grundlagenforschung in diesem Bereich prägt, ist Georg Winter. Er war unter anderem an der US-Universität Harvard tätig, bevor er als Gruppenleiter am CeMM – Forschungszentrum für Molekulare Medizin wesentliche Fortschritte bei einer besonders effizienten Form dieser künstlichen Markierungen erzielen konnte: den sogenannten Glue- Degradern. Der „molekulare Klebstoff“ sorgt dafür, dass ein krank machendes Protein sehr gezielt mit einer geeigneten E3-Ligase zusammengebracht und für den Abbau markiert wird. Das Potenzial für künftige Therapien von Krebs und vielen anderen schwerwiegenden Krankheiten ist enorm.