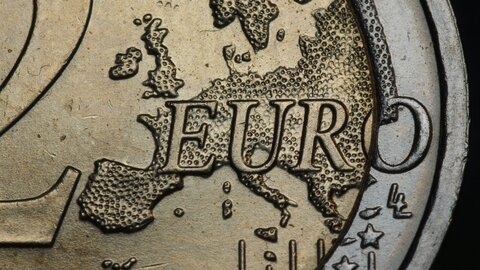Bernd Resch erforscht als Geoinformatiker an der Paris Lodron Universität Salzburg unter anderem, wie mithilfe künstlicher Intelligenz raumzeitliche Analysen so verbessert werden können, dass Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen möglich werden, etwa die Ausbreitung eines Infektionsgeschehens. Ein Schwerpunkt liegt auf Daten aus sozialen Medien und der Interpretation von Texten und Bildern mithilfe von KI-Methoden. Das WKP-Projekt „Health Detectives“ wird in Workshops und Laborversuchen Erkenntnisse und Methoden aus dieser Forschung vermitteln: Die Hauptzielgruppe sind neben einer allgemeinen Öffentlichkeit Schüler:innen, die anhand von realen Fallbeispielen lernen, wie Hypothesen gebildet werden, wie Machine-Learning funktioniert, wie Daten aus sozialen Medien gewonnen werden, welche Aussagen auf ihrer Basis möglich sind und wie man die Auswertungen für Vorhersagen nutzt. Dabei trainieren Teilnehmende selbst KI-Modelle und erstellen Karten, um räumliche Muster in der Krankheitsausbreitung erkennen zu können. Gelernt wird dabei auch spielerisch in einem „Escape-Room“ im iDEAS:lab der Universität Salzburg: Die Teilnehmenden müssen eine fiktive Pandemie bewältigen. „Es ist uns ein sehr großes Anliegen, Verständnis dafür zu schaffen, wie wissenschaftliche Prozesse funktionieren, damit Bürger:innen sich eine fundierte Meinung bilden können. Das ist für eine funktionierende Demokratie unabdingbar“, erklärt Bernd Resch.
Geteiltes Wissen, gemeinsame Begeisterung: Sieben neue Wisskomm-Projekte starten

Bei einem Fördervolumen von insgesamt 645.000 Euro förderte der Wissenschaftsfonds FWF 2023 sieben Projekte im Rahmen des Wissenschaftskommunikationsprogramms (kurz: WKP). Gefördert werden neue Ansätze der Vermittlung von Erkenntnissen aus herausragenden, FWF-geförderten Forschungsprojekten an eine breite Öffentlichkeit. „Neben der Verbreitung von Wissen und von wissenschaftlichen Methoden geht es uns bei diesem Programm darum, das Vertrauen in die Wissenschaft zu erhöhen“, so Christof Gattringer, Präsident des FWF, zu den Zielen des Programms.
Die Auswahl der Kommunikationsprojekte
Eine renommierte Fachjury wählte unter insgesamt 28 Anträgen die sieben Kommunikationsprojekte aus. Zur Jury gehören Gian-Andri Casutt, ETH-Rat, Schweiz; Oliver Lehmann, Institute of Science and Technology Austria (ISTA); Christian Müller, Austria Presse Agentur; Jutta Rateike, DFG, Deutschland und Barbara Streicher, ScienceCenter-Netzwerk. Die WKP-Jurysitzung fand Im November 2023 statt.
Das Programm für den Dialog mit der Öffentlichkeit
Der Wissenschaftsfonds FWF unterstützt mit dem Wissenschaftskommunikationsprogramm Forschende bei neuen und innovativen Projekten im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Auf Basis der Empfehlungen einer Expert:innen-Jury bewilligte der FWF 2023 sieben Anträge mit einem Fördervolumen von rund 645.000 Euro, davon ein Antrag aus der Themenförderung „Sustainable Food Systems“. Das Wissenschaftskommunikationsprogramm des FWF besteht seit 2013.
Die neue Ausschreibung des Wissenschaftskommunikationsprogramms startet am 5.2.2024. Bitte beachten Sie die neuen Antragsrichtlinien.