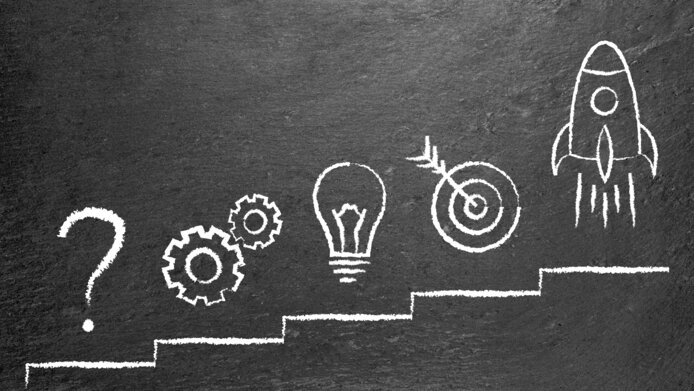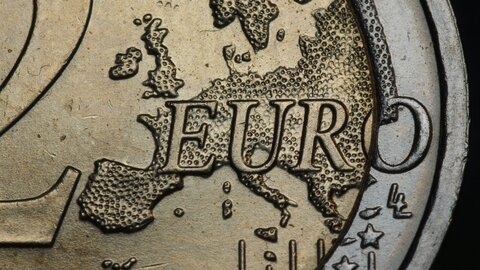Koordination: Florian Schaffenrath, Universität Innsbruck
Forschungsnetzwerk: Universität Innsbruck (Michael William Barton, Martin Korenjak, Johanna Luggin, Federica Rossetti, Patryk Ryczkowski, Isabella Walser-Bürgler)
Fördervolumen: 3,9 Millionen Euro / vier Jahre Laufzeit (Förderentscheidung zu einem zusätzlichen Teilprojekt an deutscher Forschungsstätte folgt im Februar 2025)
Während die Neulateinforschung in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt durch verschiedene Initiativen an der Universität Innsbruck – erhebliche Fortschritte gemacht hat, kämpft sie weiterhin mit zwei Problemen: Erstens ist die kulturelle und lebensweltliche Verankerung der in der Frühen Neuzeit entstandenen lateinischen Literatur bisher nur punktuell erforscht, sodass das Verständnis ihrer vielfältigen Funktionen in dieser Epoche unscharf bleibt. Zweitens sind die meisten neulateinischen Texte für Frühneuzeitforscher:innen, die des Lateinischen nicht mächtig sind, nach wie vor kaum zugänglich, weshalb sie diese Texte oft ganz ausblenden. Der neue Spezialforschungsbereich an der Universität Innsbruck will diese Lücken schließen.
Die Wissenschaftler:innen in Innsbruck werden gemeinsam mit internationalen Kolleg:innen die Wechselwirkung der neulateinischen Literatur mit zentralen Aspekten der frühneuzeitlichen Welt beleuchten und durch eine strukturierte Zusammenstellung digitaler Werkzeuge (Datenbank, Textsammlung, KI zur Erschließung neulateinischer Texte) ermöglichen, dass Forscher:innen im Bereich der Frühneuzeit neulateinische Texte als Quellen für ihre Fragestellungen finden und selbstständig nutzen können.