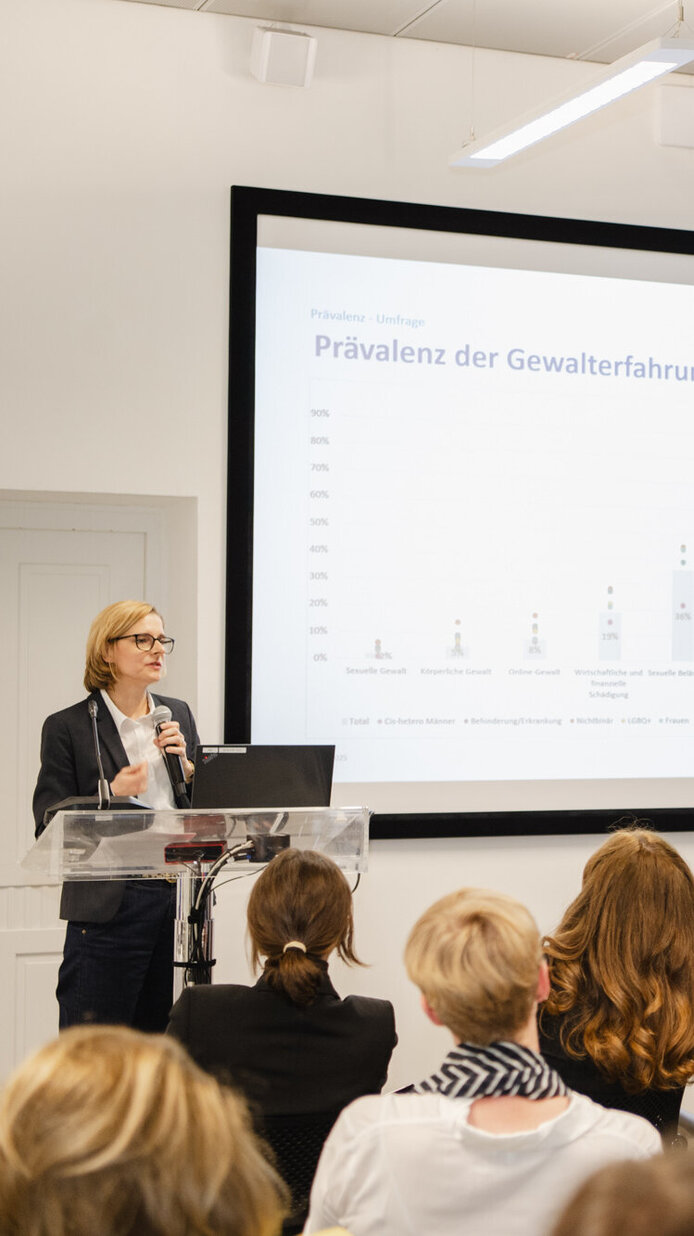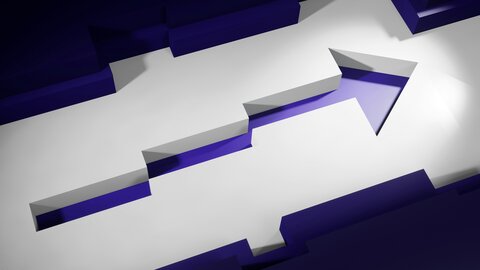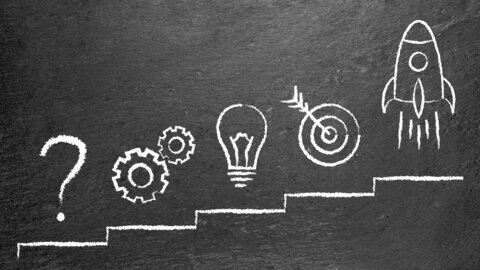Praktische Ansätze und institutionelle Verantwortung
Am Nachmittag lag der Fokus auf Lösungsansätzen. Marlene Hock (FWF) stellte den Leitfaden für eine sichere und vielfältige Forschungskultur vor. Dieser bietet Informationen und Empfehlungen, zeigt mögliche Konsequenzen auf und ist ein Bekenntnis des FWF zu einer sicheren und respektvollen Arbeitskultur, in der Forschung exzellente Ergebnisse hervorbringen kann.
Als ein Beispiel für gelungene Sensibilisierungsarbeit präsentierten Lisa Appiano und Nina Krebs (Universität Wien) im Anschluss die Kommunikationskampagne u:respect, mit der die Universität Wien in mehreren Formaten (u. a. Videos, Leitfäden, E-Learning) eine Kultur des Respekts durch Wissen, Sichtbarkeit der Maßnahmen und Vertrauen in die Organisation (Transparenz und Infos, sowie Stärkung des Umfelds) etablieren möchte.
Externe Expertise, kollektives Handeln
Sophie Rendl, Expertin für Gewaltschutz im Kunst- und Kulturbereich, unterstrich im letzten Beitrag die Relevanz von unabhängigen Anlaufstellen. Sie machte deutlich, dass Machtmissbrauch begünstigende Faktoren – befristete Verträge, unsichere Einkommensverhältnisse, wirtschaftliche Abhängigkeiten – ein kollektives, strukturelles Problem seien, nicht nur ein moralisches Versagen Einzelner.
Gemeinsame Verantwortung für sichere Forschungskultur
In der abschließenden Diskussion sammelten die Teilnehmenden zentrale Handlungsempfehlungen:
- Unabhängige Anlaufstellen einrichten
- Interne Anlaufstellen stärker vernetzen und Wissenslücken füllen
- Verpflichtende Schulungen für Führungskräfte verankern
- Voraussetzungen für Fördergelder reflektieren – Schutzmaßnahmen/Sicherheitskonzepte als Kriterium etablieren
- Bewusstsein für Intersektionalität schärfen
- Politischer Wille für langfristige Finanzierung von Gleichstellungsarbeit und Anlaufstellen
- Kooperationen und Vernetzung von Gleichstellungsarbeit institutionenübergreifend ausbauen, zum Beispiel für gemeinsame Kampagnen
Ausblick
Die Tagung hat deutlich gemacht: Es braucht nicht nur Problembewusstsein, sondern konkrete Strukturen, verpflichtende Standards, unabhängige und vertrauensvolle Anlaufstellen. Und eine Organisationskultur, in der der Umgang mit Macht und Verantwortung reflektiert wird und die geschulten Führungskräfte sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
Die Organisator:innen (FWF, FFG, TU Wien und die weiteren Mitglieder der genderAG) sehen sich bestärkt, gemeinsam mit der Politik und den österreichischen Forschungsstätten den Weg in Richtung eines diskriminierungsfreien Forschungsumfeldes weiterzugehen.