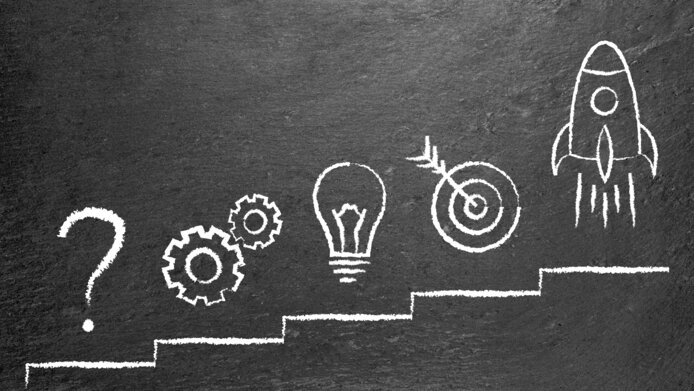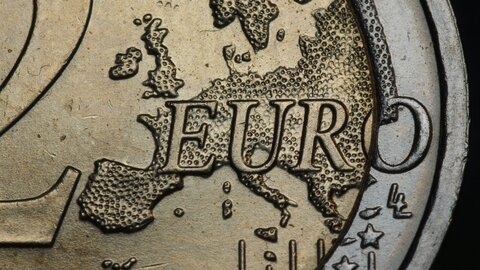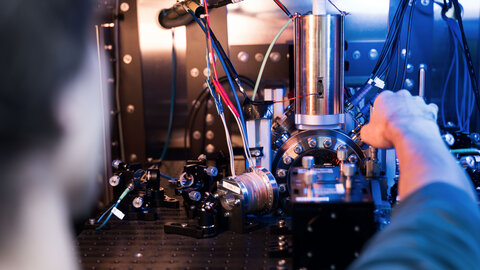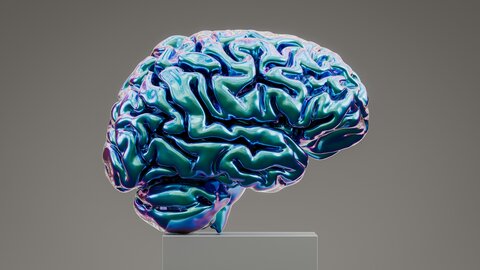Koordination: Nathanael Berestycki, Universität Wien
Forschungsnetzwerk: TU Wien (Michael Drmota, Marcin Lis, Benedikt Stufler, Fabio Toninelli), Universität Wien (Ilse Fischer, Christian Krattenthaler), TU Graz (Mihyun Kang)
Fördervolumen: 4,3 Millionen Euro / vier Jahre Laufzeit
Im Zentrum dieses Forschungsnetzwerkes stehen zufällige diskrete Strukturen, die allgegenwärtig in vielen Bereichen der modernen Mathematik, aber auch essenziell für die Beschreibung diverser Phänomene in der mathematischen Physik sind. Sie spielen zum Beispiel eine Schlüsselrolle, um Phasenübergänge zu verstehen, die physikalische Systeme bei abrupten Veränderungen durchmachen – wie Wasser beim Übergang vom flüssigen zum festen Zustand, wenn die Temperatur unter null fällt. Dazu werden in diesem Spezialforschungsbereich verschiedene zweidimensionale Modelle betrachtet, wie das berühmte Dimer Model und planare Graphen. Es werden dabei probabilistische und kombinatorische Sichtweisen vereint, um fundamentale Fragen über diese Modelle zu beantworten. Wie können sie abgezählt werden, entweder exakt oder näherungsweise? Wie kann man ihre Zufallsgeometrie unter geeigneter Skalierung verstehen? Wie kann man die faszinierende Beobachtung erklären, dass die gleichen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten in ganz verschiedenen Kontexten immer wieder auftreten? Solche Fragen haben tiefliegende Verbindungen zur mathematischen Physik, von topologischen Phasenübergängen bis hin zur Liouville-Quantengravitation, die untersucht werden.