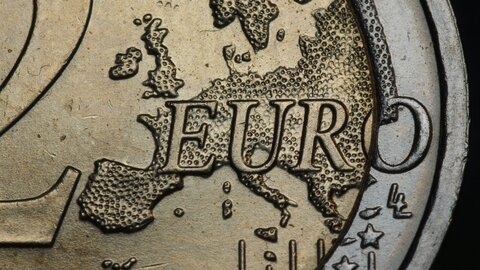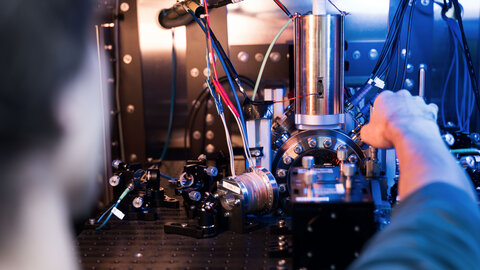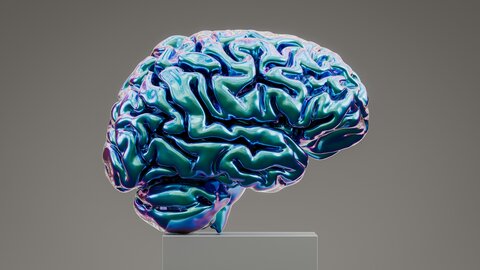Gut zwei Drittel der erwachsenen Österreicher:innen – Politiker:innen eingeschlossen – wissen nicht, was Geld eigentlich ist. Das ist eines der Ergebnisse wirtschaftssoziologischer Studien, die Klaus Kraemer zum Thema Geld durchgeführt hat und seiner Forschungsgruppe den Anlass gaben, das Forschungsprojekt zur Nutzung barer und unbarer Zahlungsmethoden („Payment Methods in Motion“) durch ein Citizen-Science-Projekt zu ergänzen, das den „digitalen Euro“ zum Thema macht. „Vielen ist nicht bewusst, dass mit den digitalen Bezahlmethoden wie PayPal, Apple- oder GooglePay auch die Geldschöpfung zunehmend in privater Hand ist. Nur fünf Prozent des Geldes, mit dem wir zu tun haben, wird von der Europäischen Zentralbank ausgegeben und das ist bislang ausschließlich Bargeld“, so Kraemer. Der digitale Euro, der in den nächsten Jahren erstmals ausgegeben werden soll, wäre somit das einzige öffentliche Digitalgeld. Was denken EU-Bürger:innen darüber? Was wissen sie? Das Top-Citizen-Science-Projekt wird zwei Bürger:innen-Konferenzen durchführen, einmal mit Schüler:innen, einmal mit einer für die österreichische Bevölkerung repräsentativen Zusammensetzung. Die Teilnehmenden werden sich in diesen Konferenzen über den digitalen Euro informieren und mit Methoden der Sozialforschung ihre Einstellungen dazu erheben, um diese kritisch zu hinterfragen. Die Soziolog:innen wiederum nutzen die Prozesse, um zu verstehen, wie sich Einstellungen entwickeln und möglicherweise verändern. „Aus unseren Studien wissen wir, dass das Misstrauen gegenüber Institutionen wie der EZB groß ist. Mit dem Citizen-Science-Projekt erfahren wir hoffentlich mehr darüber, warum das so ist und ob Partizipation und Information daran etwas ändern“, so Kraemer.
Offene Wissenschaft: Fünf neue Top-Citizen-Science-Projekte

Wissenschaft ist nie weit von Gesellschaft und Alltag entfernt. Das zeigen die fünf Projekte, die in diesem Jahr durch die Förderung des FWF-Programms Top Citizen Science zwei Jahre lang gemeinsam mit Nichtwissenschaftler:innen, darunter viele Jugendliche und Schüler:innen, durchgeführt werden können. „Die Projekte in diesem Jahr sind von besonders großer Relevanz sowohl für Bürger:innen als auch für die Wissenschaft. Keines der Projekte wäre möglich ohne die Einbeziehung von Lai:innen, was unser Vertrauen in diese Art der Forschung und in unsere Förderschiene noch verstärkt“, sagt Christof Gattringer, Präsident des FWF.
In diesem Jahr werden durch den FWF fünf Top-Citizen-Science-Projekte gefördert. Das Fördervolumen beträgt 460.000 Euro; von den Kommunikationswissenschaften, die Soziologie und die Veterinärwissenschaften über die Mikrobiologie bis hin zur Kunst- und Kulturgeschichte sind natur-, sozial- und geisteswissenschaftliche Disziplinen vertreten.
Alle Top-Citizen-Science-Projekte sind Teil eines vom FWF geförderten Basis-Forschungsprojekts und ergänzen dieses. Auf diese Weise wird ein sehr hohes akademisches Niveau sichergestellt.
Die aktuellen Projekte laufen 2025 bis 2026. Wir stellen vier der fünf Projekte vor.
Über Top Citizen Science
Top Citizen Science fördert Forschungsaktivitäten, die eine Beteiligung von Bürger:innen ermöglichen, welche somit zu einem substanziellen, zusätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Die wissenschaftliche Qualität der Top-Citizen-Science-Projekte wird durch ein zugehöriges FWF-Forschungsprojekt („Basisprojekt“) sichergestellt, das bis zur Förderentscheidung (Oktober des Einreichjahres) noch nicht abgeschlossen ist. Ein Top-Citizen-Science-Projekt kann maximal 24 Monate dauern und eine Förderung von maximal 100.000 Euro erhalten. Die Entscheidung über die Förderung als Top-Citizen-Science-Projekt trifft das Kuratorium des FWF auf Grundlage einer internationalen Begutachtung.