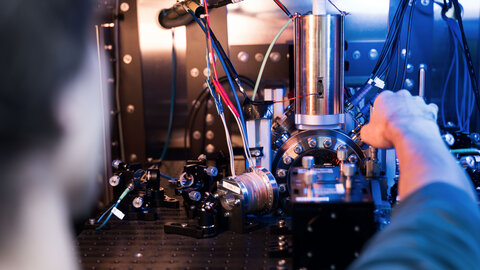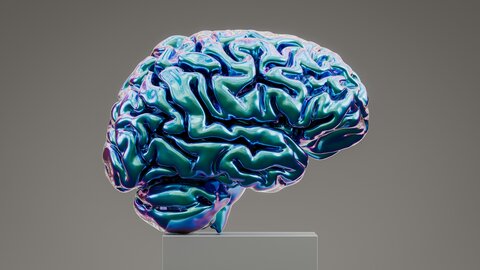Welche Bewegungen machen Sandkörner im Inneren eines Hanges, wenn dieser versagt? Das Projekt „Granulare Perspektiven“ bringt einen Künstler und Wissenschaftler:innen zusammen und macht diese verborgenen Kornbewegungen sichtbar und verständlich. „Unser Projekt verbindet Kunst und Wissenschaft, um die Öffentlichkeit – insbesondere Kinder und Jugendliche – für die faszinierende Welt granularer Materialien wie Sand zu begeistern“, erläutert Medicus. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Glasskulptur, die mechanische Vorgänge in granularen Materialien – wie Sand – anschaulich zeigt. Medicus weiter: „Diese Glasskulptur macht die unsichtbaren Kräfte und Wechselwirkungen von Sandkörnern sichtbar. Damit wollen wir wissenschaftliche Konzepte spielerisch vermitteln.“ Dieses Wissenschaftskommunikationsprojekt soll damit das Bewusstsein für die begrenzte Ressource Sand und deren nachhaltige Nutzung steigern. Workshops und Ausstellungen richten sich an Kinder insbesondere im Alter von sieben bis zehn Jahren und Jugendliche von 16 bis 19 Jahren und sollen besonders das Interesse von Mädchen und jungen Frauen an Technik und Ingenieurwissenschaften fördern. Das Projekt weckt Neugier, vermittelt die Faszination für das Material Sand und eröffnet neue Wege der Wissenschaftsvermittlung in der Geomechanik. Die interaktive Skulptur bildet dabei das Zentrum und wird durch didaktische Formate ergänzt, die Neugier und eigenes Explorieren fördern.
Von Musik bis Sprache: Wie fünf Projekte Wissenschaft für alle zugänglich machen

Wie vielfältig Wissenschaft sein kann, zeigen die fünf neuen Wissenschaftskommunikationsprojekte, die jeweils auf ganz eigene Weise Forschung sichtbar, hörbar und erlebbar machen. Ob es um die verborgenen Bewegungen von Sandkörnern, den Klangvergleich der berühmtesten Neujahrskonzertaufnahmen, die chemischen Prozesse in pflanzlichen Ölen, gesellschaftliche Perspektiven auf Sucht oder die reiche Dialektlandschaft Österreichs geht – alle Projekte eint das Ziel, komplexe Erkenntnisse zugänglich zu machen und Neugier zu wecken.
Mit kreativen Formaten, interaktiven Exponaten und innovativer Wissenschaftskommunikation eröffnen sie neue Wege, um Forschung unmittelbar erfahrbar zu machen und Menschen jeden Alters einzubeziehen. Die Projekte starten im Jänner 2026 und sind auf maximal zwei Jahre ausgelegt.
Das Programm Wissenschaftskommunikation für den Dialog mit der Öffentlichkeit
Der Wissenschaftsfonds FWF unterstützt mit dem Programm Forschende bei neuen und innovativen Projekten im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Das Förderangebot richtet sich an Wissenschaftler:innen an österreichischen Forschungsstätten, die ein FWF-gefördertes Projekt leiten bzw. geleitet haben. Eine zentrale Zielsetzung ist die Förderung hervorragender wissenschaftskommunikativer Maßnahmen, um wissenschaftliche Inhalte aus FWF-geförderten Projekten der Gesellschaft zu vermitteln.