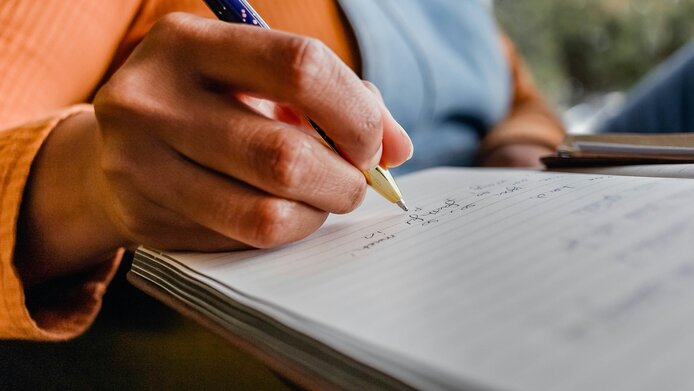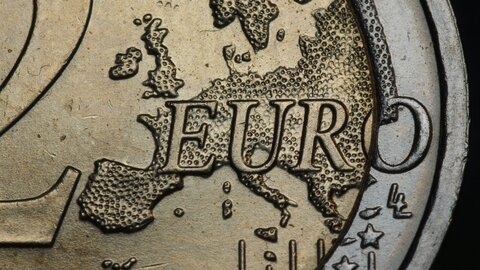Arbeiten in der Spitzenforschung: Befristungen, Arbeitspensum und Karriereziele
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten befindet sich in einem befristeten Dienstverhältnis, besonders für Frauen und generell für alle unter 40 Jahren ist eine Befristung eher die Norm als die Ausnahme. Längere Laufzeiten bis zu 36 Monaten finden sich bei älteren Forschenden, kürzere Befristungen betreffen jüngere Personen. Mit dem Alter steigt unabhängig vom Geschlecht das Arbeitspensum an. Knapp die Hälfte ihrer Arbeitszeit widmen die Befragten dem Forschen, gefolgt von Aufgaben in Lehre, Management, Betreuung und der Drittmittelakquise. Wissenschaftler:innen an außeruniversitären Forschungsstätten steht im Vergleich zu Kolleg:innen an den Universitäten mehr Zeit zum Forschen zur Verfügung. Der Zeitaufwand für die Drittmittelakquise bleibt im Vergleich zu früheren Umfragen konstant bei etwa 8 Prozent.
Während fast 90 Prozent der Befragten eine unbefristete Stelle im wissenschaftlichen Bereich anstreben, geben sie sich selbst eine relativ ernüchternde Chance von etwa 25 Prozent, diese auch zu erreichen. Dies verdeutlicht die ausbaufähigen Karriereperspektiven im Bereich der Wissenschaft, speziell für den Nachwuchs.
Verfügbarkeit von Drittmitteln erhöht Attraktivität des Standorts
Einen entscheidenden Finanzierungsanteil an den Forschungsaktivitäten in Österreich machen Drittmittel aus. Es gehört zum Alltag der Forschenden, ihr Forschungsbudget vollständig oder zumindest teilweise aus Drittmitteln aufzustellen. Ein Drittel der Stichprobe stellt das eigene Forschungsbudget beinahe zur Gänze aus Drittmitteln auf, im Durchschnitt basieren laut eigener Einschätzung knapp 65 Prozent des eigenen Forschungsbudgets auf Förderungen. Wichtigste Adresse bei Förderansuchen in der Grundlagenforschung ist naturgemäß der FWF, dem es daher nicht an Bekanntheit innerhalb der wissenschaftlichen Community mangelt. Von den befragten Wissenschaftler:innen hat die überwiegende Mehrheit auch einen Förderantrag beim FWF gestellt – je weiter die Karriere fortgeschritten, desto breiter das Spektrum von Förderorganisationen auf nationaler und europäischer Ebene.
Nachfrage weitaus höher als Angebot
Antragsaufwand und potenzieller Ertrag werden von den Befragten im Hinblick auf unterschiedliche Fördergeber auch unterschiedlich eingeschätzt. Anträge auf europäischer Ebene werden als aufwendig im Vergleich zum möglichen Ertrag eingestuft. Für den FWF fällt das Ergebnis etwas gemäßigter, aber auch zweischneidig aus: Die Hälfte der Befragten findet den Aufwand eher hoch oder sehr hoch. Diese Einschätzung dürfte auch mit den hohen Ablehnungsquoten aufgrund der zu geringen finanziellen Ausstattung des FWF zusammenhängen.
Nachwuchs hadert mit unsicheren Karriereaussichten
Der wissenschaftliche Nachwuchs kämpft in erster Linie mit dem Problem unsicherer Karriereperspektiven. Acht von zehn Postdocs aus allen wissenschaftlichen Disziplinen haben Zweifel an den Karriereaussichten im akademischen Umfeld. Ergänzend dazu werden lange Qualifizierungen, nicht wettbewerbsfähige Einkommensmöglichkeiten und hierarchische Strukturen, die die Selbstständigkeit beeinträchtigen, als kritische Karrierefaktoren genannt.
Ein klares Ist-Soll-Gap gibt es für die Kriterien der Leistungsbeurteilung. Wissenschaftliche Publikationen sind aktuell das Kriterium, das laut den meisten Befragten ausschlaggebend ist. Das ist auch so gewünscht und soll sich nicht ändern. Andere aktuell ausschlaggebende Kriterien sind laut Einschätzung der Befragten bereits erfolgreich eingeworbene Drittmittel und interne Netzwerke. Diese aber, so der Tenor der Umfrage, sollen an Bedeutung verlieren. Im Vergleich zur Ist-Situation sollten dafür Lehre, Wissenschaftskommunikation und gesellschaftliche Relevanz für die Leistungsbeurteilung eine größere Rolle spielen.
Die Rolle von Vorgesetzten und Mentor:innen werden vornehmlich positiv gesehen. Der wissenschaftliche Nachwuchs wird hinsichtlich Unabhängigkeit gefördert und es besteht Offenheit und Entgegenkommen, dass jüngere Forscher:innen eine eigenes wissenschaftliches Profil entwickeln können. Etwas weniger gut schneiden Vorgesetzte einzig bei der Unterstützung einer langfristigen Karriereplanung ab.
Ungewisse Karriereentwicklung als bleibender Unsicherheitsfaktor
Rund zwei Drittel der Wissenschaftler:innen sind mit ihrem Job (sehr) zufrieden. Aspekte, die kritischer gesehen werden, sind die berufliche Position, die Lehrtätigkeit und besonders die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, wobei Letzteres von Frauen jeder Altersstufe kritischer gesehen wird. Obwohl die Gesamtzufriedenheit mit der beruflichen Situation respektabel ausfällt, hat die Hälfte der Wissenschaftler:innen in letzter Zeit überlegt, den akademischen Bereich zu verlassen. Überproportional stark sind diese Gedanken bei Personen in den Zwanzigern und Dreißigern ihres Lebens. Dafür zeichnen sich unabhängig vom Geschlecht drei entscheidende Faktoren ab: die Themen „zeitliche Befristung der Stelle“ und „Kettenvertragsproblematik“, die in allen Altersgruppen auftauchen, aber bis Ende 30 noch unbefriedigender sind, sowie die „ungewisse Karriereentwicklung“, die zwischen 30 und 49 Jahren für Zweifel sorgt.
Erfahrungen mit Diskriminierung und wissenschaftlicher Integrität
Jede vierte befragte Person hat laut eigener Angabe Diskriminierung am Arbeitsplatz (Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter) selbst erlebt oder bei anderen beobachtet, Frauen sind häufiger von Diskriminierung betroffen. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Integrität hat mehr als die Hälfte der Befragten kritische Beobachtungen gemacht, speziell Probleme rund um die Autor:innenschaft werden hier angeführt.
Blick auf das Wissenschaftssystem: Reformwünsche und Stärkefelder
Die Spectra-Umfrage zeigt, wo der Schuh drückt und wo aus Sicht der Forschenden Reformbedarf im Wissenschaftssystem besteht: Die mit Abstand wichtigsten Themen, die breite Unterstützung finden, sind der Ausbau unbefristeter Stellen unterhalb der Professur, der Ausbau von Open Science und umfangreichere Möglichkeiten zur Freistellung für Forschung sowie die Implementierung von flacheren Hierarchien. Bei den Stärken des österreichischen Wissenschaftssystems rangieren Autonomie und Forschungsfreiheit ganz vorne (75 Prozent sehr gut oder gut). Auch gut, aber etwas weniger positiv werden die gesellschaftliche Relevanz der Forschung, die Leistungsfähigkeit im internationalen Vergleich und die Innovationsfähigkeit bewertet. Am kritischsten wird die geringe Wertschätzung durch die Gesellschaft gesehen.
Positives Feedback für Förderabwicklung und Beratungsqualität des FWF
Die Qualität der Informationen, Richtlinien und Beratung im Zuge der Einreichung eines Förderantrags wird von der überwiegenden Mehrheit der Befragten sehr positiv beurteilt. Verbesserungspotenzial gibt es bei der Nachvollziehbarkeit der Ablehnungen, speziell auch angesichts der geringen Bewilligungsquoten – ein Thema, das der FWF stärker in den Fokus nehmen wird. Die Mehrzahl der Befragten empfindet die Bearbeitung unbürokratisch sowie die Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren transparent.
Österreichs größte Studie unter Forschenden
Die Studie „Befragung der wissenschaftlichen Community 2025“ wurde im Mai und Juni 2025 von der Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH im Auftrag des Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF nach einer wettbewerblichen Ausschreibung durchgeführt. Die Ergebnisse beruhen auf einer umfangreichen Befragung innerhalb der wissenschaftlichen Community in Österreich – rund 20.000 Forschende, die potenziell beim FWF antragsberechtigt sind –, wovon 3.368 Wissenschaftler:innen teilgenommen haben. Hauptstudienautor ist Thomas Wolfschluckner, Senior Research Director bei der Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH.